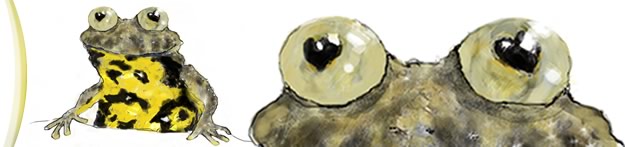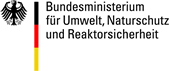Naturschutzgenetik
Hintergrund
Naturschutzgenetik ist eine verhältnismäßig neue Teildisziplin der Ökologie, die schnell an Bedeutung für den Natur- und Artenschutz gewonnen hat. Mit ihrer Hilfe werden die genetischen Strukturen innerhalb von Populationen und ihre Veränderungen im Laufe der Populationsgeschichte untersucht.
Mittels molekularer Methoden ist es möglich, Populationsstrukturen einzelner Arten zu ermitteln und so zum Beispiel Daten über die genetische Zusammensetzung, genetische Flaschenhälse, Inzucht und den genetischen Austausch von Populationen zu gewinnen.
Es können wichtige Diversitätszentren einer Art ermittelt und mit angepassten Schutzprogrammen dauerhaft bewahrt werden. Autochthone Populationen, also solche die ein Gebiet natürlich besiedeln und für dieses günstige, genetisch fixierte, einzigartige Eigenschaften besitzen, können identifiziert und dann besonders geschützt werden. Mit Hilfe naturschutzgenetischer Methoden kann man gegenwärtige Verbreitungsmuster und historische Ausbreitungswege einer Art untersuchen. Es können Prozesse wie Zerschneidung oder Individuenaustausch zwischen Populationen innerhalb von Verbreitungsgebieten erkannt werden.
Ziele
Ziel ist es, die genetische und phylogeographische Struktur von Populationen der Gelbbauchunke in allen Projektregionen zu analysieren. Die genetische Analyse von Populationen dient als Grundlage für Wiederansiedlungen und die Vernetzung von Populationen, damit nur auch ehemals vernetzte Populationen wiedervernetzt werden.
Im Rahmen einer Kooperation mit der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) Hannover werden genetische Analysen an in das Projekt einbezogenen Populationen durchgeführt. Ein genetisches Monitoring ist für die Bewertung der Bestands- und Gefährdungssituation sehr hilfreich. Es kann Hinweise darauf liefern, welche Populationen aktive Schutzmaßnahmen erfordern. Anhand der gewonnenen genetischen Daten können die Planungen des Projektes insbesondere zur Entwicklung von Vernetzungsmaßnahmen einzelner Populationen durch Trittsteingewässer und Verbindungskorridore wissenschaftlich begleitet werden.
Für die geplanten Wiederansiedlungsmaßnahmen kann anhand der gewonnenen populationsgenetischen Daten entschieden werden, aus welchen Populationen Tiere überführt werden sollen. Auch können anhand der genetischen Befunde Hinweise geliefert werden, ob bestimmte Populationen aus unbekannten Aussetzungsversuchen stammen.
Zudem werden alle Populationen stichprobenartig auf Befall mit Chytridpilzen untersucht. In wie weit auch die Gelbbauchunken des Projektraumes betroffen sind, soll mit PCR-Nachweis untersucht werden. Durch den Chytridpilz befallene Populationen müssen bei den Vernetzungs- und Wiederansiedlungsprojekten besonders berücksichtigt werden, um eine Ausbreitung des Pilzes zu verhindern.
Der Chytridpilz-Erreger (Batrachochytrium dendrobatidis), der wahrscheinlich die natürlichen biologischen Funktionen der Haut der Amphibien behindert, wird für weltweites Amphibiensterben verantwortlich gemacht und tritt auch in Europa auf.
Material und Methoden
Aus jeder projektrelevanten Population werden von jeweils 10 - 20 adulten Unken Mundschleimhautproben genommen. Diese Speichelproben werden mit Hilfe eines Wattestäbchens gewonnen und enthalten genetisches Material eines jeden Individuums (Abb. 1). Anschließend wird die DNA aus den Speichelproben extrahiert.

Abb.1: Beprobung von Gelbbauchunken zur Gewinnung
von Speichelproben für die genetische Analyse
 Die Analyse des genetischen Materials aus den einzelnen Populationen erfolgt mit Hilfe von Mikrosatelliten (Abb. 2). Diese nicht kodierenden DNA-Bereiche bestehen aus kurzen, repetitiven Basenpaarfolgen, die einer sehr hohen Mutationsrate unterliegen. Da sich die Anzahl der Wiederholungen bei verschiedenen Individuen unterscheidet (Mikrosatelliten-Polymorphismus), lässt sich eine Population durch eine PCR-Analyse verschiedener Mikrosatelliten-Loci in ihrer Diversität beschreiben.
Die Analyse des genetischen Materials aus den einzelnen Populationen erfolgt mit Hilfe von Mikrosatelliten (Abb. 2). Diese nicht kodierenden DNA-Bereiche bestehen aus kurzen, repetitiven Basenpaarfolgen, die einer sehr hohen Mutationsrate unterliegen. Da sich die Anzahl der Wiederholungen bei verschiedenen Individuen unterscheidet (Mikrosatelliten-Polymorphismus), lässt sich eine Population durch eine PCR-Analyse verschiedener Mikrosatelliten-Loci in ihrer Diversität beschreiben.
Um die phylogeographische Abstammung einzelner Populationen zu bestimmen wird insbesondere die mitochondriale DNA der Tiere analysiert, da diese vor allem in ihrer nicht kodierenden Kontroll- oder D-Loop-Region einer hohen Mutationsrate unterliegt und sich daher zur Unterscheidung postglazialer genetischer Linien eignet. Auch der für das Cytochrom B kodierende, konservierte Abschnitt der mitochondrialen DNA wird für phylogenetische Studien verwendet. Beide Regionen werden durch den Einsatz entsprechender Primer in einer Polymerasekettenreaktion (PCR) amplifiziert und anschließend sequenziert und mithilfe von verschiedenen Computerprogrammen analysiert.
Abb. 2: Labor für genetische Analysen an der TiHo Hannover
Ansprechpartner
Prof. Dr. Heike Pröhl
Institut für Zoologie
Tierärztliche Hochschule Hannover
Bünteweg 17
30559 Hannover
Tel.: 0511/9538431
E-Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!